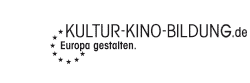Ingrid Wiener
Das Leben in der Kunst
Die Gobelins in der Ausstellung im Marta Herford sind spektakulär. In der Perspektive schräg von oben, in den Perspektivwechseln auf der gewebten Fläche mit dem dadurch Zusammengerückten und übereinander Geschobenen, das noch Lichtreflexe und Schatten einbezieht, zeigen sie häusliches Leben und demonstrieren körperliches Bewusstsein. Sie geben das Sehen, Denken und Kombinieren von Ingrid Wiener wieder. Sie zeigen ihr Wahrnehmen und zugleich handwerkliches Vorgehen, sind dahingehend selbstreflexiv und schildern noch die Entstehung der Gobelins selbst, etwa indem sie den Webstuhl selbst abbilden. Der konzentrierte, dabei malerische Realismus der Darstellungen ist frappierend; neben die Kombinatorik der Dinge tritt das Disparate, das auf das Verfahren der Collage weist (- und auch solche gibt es, auf Papier). Dazu kehrt sie die langen auslaufenden Fäden der Gobelins nach vorne, so dass sie nicht nur die Webtechnik selbst offenlegen, sondern auch das bildnerische Geschehen überdecken, ihm eine Bühne geben und diesen Raum weiter mit Energie aufladen. Wo sie auf der Rückseite des Gobelins bleiben, schieben sie diesen wie ein Relief von der Wand weg. Mit dem privaten motivischen Vokabular aber, seiner Assoziationsfähigkeit und Kombinatorik, gehen subtile Schilderungen einher, etwa auch wenn sie ein Kochrezept wiedergibt und mit den Fäden die Darstellungen farblich nuanciert.
Die Ansichten der Gobelins evozieren die Vorstellungen eines Rauschs, der das menschliche Gehirn gleichsam von der Welt entkoppelt und das eigene Tun und die Dinge vor einem wie aus der Ferne beobachten lässt. Sind es in jüngster Zeit die Röntgenbilder von Körperorganen, die für Ingrid Wiener mit eigenen Erfahrungen verbunden sind, so war es davor häufig der Blick aus dem Fenster oder auf die Dinge und Gerätschaften der eigenen Wohnung, etwa als Stillleben. Das betrifft in der Ausstellung im Marta Herford zum Beispiel eine Brille auf einem Schneidebrett oder zusammengeschobene Feldgurken. Wiedergegeben sind auch Röhren, Kabel, die auf dem Boden liegen und zum Fernseher, Computer, Wollknäuel gehören, sich überkreuzen und wie eine Schlange winden. Ein Gobelin aus der Sammlung des MAK in Wien trägt den Titel „Dr. Müllers Kabelfrühling“ (2009-2010). Dazu blinkt und leuchtet es in diesen Gobelins je nach Standpunkt, dann wenn Ingrid Wiener Lurex-Fäden eingewoben hat.
Das Medium der Tapisserie erinnert mithin an die Wissenschaft der Kybernetik, zumal in den Gobelins auch Computer auftauchen. „Kybernetik ist die Wissenschaft von der Steuerung und Regelung in lebenden Organismen, technischen Systemen und sozialen Organisationen, die sich mit Informationsverarbeitung und Kommunikation beschäftigt. Sie analysiert, wie Systeme durch Rückkopplung ihre Funktionen anpassen können, um Stabilität und Zielgerichtetheit zu erreichen.“ (KI, abgerufen am 22.10.25) Ingrid hat Oswald Wiener (1935-2021), einen der Begründer dieser Wissenschaft und späteren Professor an der Kunstakademie Düsseldorf, schon als Jugendliche im Herbst 1958 kennengelernt, bei den Proben zum „ersten literarischen cabarett“, und war mit ihm seit 1965 verheiratet: dem „Kybernetiker, Sprachtheoretiker, Musiker, Avantgardepoet, Kneipier, Kunstprofessor und Querdenker“ (Oliver Jungen, FAZ vom 28.1.2017). Die Welt, die sie sieht, hat mit der von Oswald Wiener zu tun, und umgekehrt. Und dann fällt auf, dass der Webstuhl und, wie Kathleen Rahn, die Leiterin des Marta Herford, ergänzt, der Lochkarten-Webstuhl als eine Vorform des Computers gedeutet werden können.
Geboren 1942 in Wien, hat Ingrid Wiener an der dortigen Textil-Fachhochschule studiert. Sie befreundet sich mit ihrer Kommilitonin Waltraut Lehner, die später unter dem Namen VALIE EXPORT bekannt wird. Zum künstlerischen Umfeld, in dem sie ihren Mann begleitet und selbst an Aktionen teilnimmt, gehören die „Wiener Gruppe“ und dann die „Wiener Aktionisten“ mit ihren Performances und Filmen. Im Juni 1968, auf dem Höhepunkt der Studentenunruhen, wirkt Oswald Wiener im Neuen Wiener Universitätsgebäude vor vollem Haus an der heute legendären, aufwühlenden Aktionsveranstaltung „Kunst und Revolution“ mit. Einige der Akteure wurden danach verhaftet. Oswald Wiener drohte nach Verbüßen einer ersten Haftstrafe eine weitere wegen Gotteslästerung: ein Grund für das Ehepaar, sich nach West-Berlin abzusetzen, wohin bereits ihr Freund Günter Brus geflohen war. Der Neuanfang fand mit Michel Würthle statt, einem weiteren Mitstreiter aus der Wiener Zeit, im Wechsel in die Gastronomie. Ingrid Wiener kochte, Michael Würthle bediente, Oswald Wiener stand hinter dem Tresen und schenkte aus. Das erste Lokal war das „Matala“, dann folgte das „Exil“ (1972 bis 1978) und sodann, alleine von Ingrid Wiener betrieben, bis 1984 das „Ax Bax“. Vor allem das „Exil“ etablierte sich als Künstlerkneipe; das Deckengemälde stammt von Günter Brus, die Tapete im Billardraum von Dieter Roth, ein Emaille-Schild an der Holzvertäfelung hat Richard Hamilton auf diesen Ort hin geschaffen. Und Kochen wurde als Kunst begriffen. Dazu kamen in den späten siebziger und frühen achtziger Jahren Gesangsauftritte und Performances als Monsti Wiener, teils mit VALIE EXPORT, etwa auch im SO 36 in Kreuzberg. Die erste gemeinsame Schallplatte 1978 enthält Schlager und Stimmungslieder. - Ich konnte ja nicht singen, aber ich hab’s gern getan, sagt Ingrid Wiener bescheiden, zurückhaltend heute dazu. Fortgeführt hat sie dies später in „Kochkonzerten“ etwa mit Jan St. Werner, Rosa Barba und ihrer Stieftochter Sarah, auch mit Gerhard Rühm und natürlich Oswald.
Mit den Gobelins aber tritt sie ganz in die bildende Kunst ein: „Nachdem meine Kochkünste bereits in einschlägigen Magazinen besprochen wurden, fand ich es an der Zeit, mich anderweitig zu beschäftigen. Fasziniert war ich vom Gobelinweben als Kunst, aber gleichzeitig war mir klar, dass es eine brotlose Kunst war“, schreibt Ingrid Wiener. „VALIE EXPORT und ich hatten bereits in Wien Gobelins gewebt und die ersten Hundertwasser-Gobelins initiiert. Das war aber nicht unser Ding. Mein Plan war, aus dieser altmodischen Kunstform etwas Neues zu machen. Malen kann ja jeder. Dieter Roth erschien mir als der richtige Künstler, mit dessen Hilfe dieser Plan umgesetzt werden könne. Denn >2 Frauen, die Gobelins weben<, wäre 1974 ein hoffnungsloses Unternehmen gewesen“, zitiert Carolin Würfel Ingrid Wiener in ihrer respektvollen Biographie (ebd., Seite 159). Die beiden ausgebildeten Textilkünstlerinnen webten ab 1974 nach Vorlagen von Dieter Roth. Die erste war, enorm vergrößert, eine gebrauchte Serviette. Für Roth hat Ingrid Wiener im Laufe von 24 Jahren dann noch fünf Teppiche erstellt.
Mitte der 1980er Jahre geben Ingrid und Oswald Wiener West-Berlin auf. Sie ziehen, fasziniert von der Weite und Leere der Landschaft, nach Dawson City am Yukon in Kanada. Schon um zu überleben, eröffnen sie auch dort ein Café, wo sie von den Künstlerfreunden aus der ganzen Welt besucht werden. Bald aber kommt im Wechsel ein neuer, weiterer Wohnort dazwischen: Oswald Wiener wird 1992 – mit seinem Buch „die Verbesserung von mitteleuropa, roman“ (1969) mittlerweile hochgerühmt – an die Kunstakademie Düsseldorf berufen, an der er bis 2004 als Professor für Ästhetik unterrichtet. Joseph Beuys und Oswald und Ingrid Wiener hatten schon lange davor, seit den Anfängen ihrer Berliner Zeit, freundschaftlichen Kontakt. Düsseldorf gilt als eine Welthauptstadt der Kunst, die offen für die Neuen Medien ist und den Kunstbegriff erweitert. Hier lebt zeitweilig auch Dieter Roth, und Daniel Spoerri führt seine „Eat Art“-Galerie und sein Restaurant. Zunächst kommt das Ehepaar im Atelier von Markus Lüpertz unter, ehe es eine Wohnung in Krefeld bezieht. Ingrid Wiener praktiziert ihre Kunst im Rheinland und in Dawson City parallel. Bereits 1986 hat sie sich in Kanada einem zweiten künstlerischen Medium zugewandt, der Zeichnung auf der Grundlage von Traumresten. Ihre „Traumzeichnungen“ verbinden, wie Sequenzen aus einem Comic, Aquarelle mit handschriftlichen Textinformationen, ergänzt noch um den Traumort und das Traumdatum. Sie sind ausgesprochen autobiographisch, kombinieren Erinnerung und Vorstellung und betreffen den Alltag und die Kunst, aber auch das Wahrnehmen selbst. Was passiert im Gehirn, wie finden unterschiedliche Erzählstränge aus dem Bewusstsein und dem Unterbewussten zusammen, wie ist die Wahrnehmung im Zustand relativer Abwesenheit? Auch hier beschäftigt sie sich mit den Fragen, die ihre Gobelins kennzeichnen, und übersetzt sie in leichte, poetisch anmutende Bilder – beide Medien führt sie bis heute fort, längst etabliert als Künstlerin mit Galerien in Berlin und Wien. In Köln wurde ihr Werk mehrfach ausgestellt, in Düsseldorf leider nicht, obwohl es 2009 kongenial in die Ausstellung „Eating the Universe“ in der Kunsthalle am Grabbeplatz gepasst hätte.
Ab den 2000er-Jahren tritt Österreich als Lebensmittelpunkt neben Dawson City; 2012 zieht das Paar wieder ganz in die Heimat zurück, nach Kapfenstein in der Steiermark. Künstlerisch entscheidend aber sind die Jahre in Kanada. Und weil die Gegend so unwirtlich und kaum besiedelt war wie das Paar es auch erwartet hatte, kam für Oswald Wiener eine Cessna mit der Möglichkeit der Vogelperspektive gerade recht. Ingrid Wiener hat aus dem Flugzeug fotografiert. Auch diese Fotografien sind in Herford ausgestellt, als Block immer in der Sicht von oben, die nichts ausspart, alles gleichberechtigt erfasst, landschaftliche Strukturen nivelliert und in die Fläche setzt und dabei nur ein Ausschnitt ist. Zu sehen sind in Herford außerdem Videos, darunter eines, in dem sie vor den Eisschollen der Arktis singt, im dicken Anorak, die Sonnenbrille im Gesicht. Das geht sehr lange und sie wirkt dort, wie einsam inmitten des Eises und mit der für den Ton empfänglichen Weite, sehr entspannt und fröhlich, fernab vom unstet ereignisreichen Leben mit seinen Wechseln von Wien nach Berlin nach Dawson City und Düsseldorf und in die Steiermark.
Ingrid Wiener – Einfach machen und tun, bis 22. Feb. im Marta Herford, Goebenstr. 2-10 in Herford
www.marta.de
Carolin Würfel: Ingrid Wiener und die Kunst der Befreiung –
Wien 1962, Berlin 1972, Hanser Berlin, Berlin 2019, 188 Seiten.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Das eigene Hab und Gut
„Grund und Boden“ in K21
Nina Fandler
Von Bild zu Bild
Linie Fläche Raum – 100 Jahre Museum Ratingen.
Jubiläumsausstellung zur Kunstsammlung und Architektur vom 13. März bis 16. August
Gino Bühler
Sensationen am Wegrand
Erde, Wasser, Luft und Feuer
„Das fünfte Element“ im Kunstpalast
Zeugnisse aus Fernost
Udo Dziersk in Hilden
Erika Kiffl
Das Atelier durchmessen
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„MITGIFT“, 2025 von Tayyib Sen
Stadt der Fotografinnen
„Perspektivwechsel“ im Stadtmuseum
Trisha Donnelly
Konzentrate der Wahrnehmung
Wände ohne Bilder
Hans-Peter Feldmann im Kunstpaalast
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
Anna Schlüters Blick auf „SELBSTPORTAIT MIT ADLERTATTOO“, Diptychon 2025 von Felix Giesen
Simon Schubert – Lichtlinien
Ausstellung der Brunhilde Moll Stiftung 12.10.25 - 31.1.26
Theater und Konzert im Dialog: DER GARTEN
5. Oktober 2025 im TEMPLUM Düsseldorf
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„ESP 06“, 2022 von Corina GERTZ
Lorenzo Pompa
Formen der Figur
Einfache Situationen
Reiner Ruthenbeck in der Skulpturenhalle bei Neuss
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
WAS BLEIBT…? 2025 von Laura Maria Görner
K.U. Wagenbach
Material als Sprache
Von Düsseldorf in die Welt
Wim Wenders in der Bundeskunsthalle Bonn
Die Stunde der Sammler
Die Sammlung Miettinen in der Philara Collection in Flingern
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
SEE YOU DOWN BELOW THE SNOW MOUNTAIN von Ana Korkia
Albrecht Fuchs
Eins mit dem Raum
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
REMIX 1, 2025 von Michael Schmidtmann