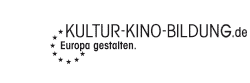Trisha Donnelly
Konzentrate der Wahrnehmung
Die Kunst von Trisha Donnelly ist still, mitunter ephemer und fast verhuscht, selbst im Überdeutlichen, das sie dann andererseits mit Energie auflädt. Sie erzeugt Bedeutsamkeit, schafft Rätsel, findet und erfindet Geschichten und erweckt die Dinge, wie sie dastehen oder diaphan an der Wand leuchten. Schwer, dass man in Erinnerung behalten kann, wie sie genau sind. Aber aus dem Kopf gehen sie erst recht nicht. Sie sind, wie die US-amerikanische Künstlerin selbstbewusst sagt, unbeschreibbar und „as alienating as poetry“. Die Skulptur setzt sich mit ihrer Unerklärlichkeit als mentale Erfahrung fort. - Trisha Donnelly wurde 1974 in San Francisco geboren. Sie hat Kunst an der University of California und an der Yale University studiert und ab 2008 an der New York University unterrichtet. Seit 2016 ist sie, als Nachfolgerin von Rosemarie Trockel, Professorin an der Kunstakademie Düsseldorf. Da war sie schon sehr bekannt, in den wichtigen Kunstinstituten der westlichen Welt vertreten. Aber sie bleibt dabei, wie es allenthalben heißt, legendär, kaum zu fassen. Sie arbeitet mit Fotografie, Film, Performance, Sound, Skulptur, Installation, Zeichnungen, die jeweils für sich stehen. Immer handelt es sich um Konzentrate aus vielen Handlungen und Perspektiven, zwischen vorgefunden und selbst geschaffen, in ihrer Diskretion einladend und ihrer Präsenz vereinnahmend. So reizt Donnelly die Grenzen der Sinneswahrnehmung aus, etwa in „Shield“ (2004), einer rein akustisch wahrnehmbaren Arbeit. Ein regelmäßig schlagender dumpfer Ton zieht das Hören derart in seinen Bann, dass er regelrecht zur physischen Architektur wird und den Realraum als Gegenüber aufbaut.
Als ein frühes Beispiel für das theatralisch Rätselhafte wird ihre Performance in der Gallery Casey Kaplan angeführt, die 2001 – kurz nach dem 11. September – in New York zu sehen war. Dort traf sie auf einem weißen Pferd in der Rolle eines Boten von Napoleon zur Eröffnung ein und trug dessen Kapitulation mit kryptischen Formulierungen vor, wendete sodann und ritt wieder in die Nacht, aus der sie gekommen war. Trisha Donnelly selbst spricht bei solchen Aktionen von Dokumentationen. Diese sollen nicht gefilmt oder sonst wie erfasst werden, sie sollen lediglich durch die Berichte der Augenzeugen fortleben. Umso mehr stellt sich die Frage, ob es wirklich so war. Und wenn, war dann Trisha Donnelly überhaupt die Reiterin? Das faktische Dasein wirkt bei ihrem Werk unerklärlich, es wirft Fragen auf und führt dazu, genau hinzuschauen, Zeit dazulassen und dann doch zu zweifeln. Immerhin gab es eine Fortsetzung bei ihrer ersten Schau in Deutschland, anlässlich der Auszeichnung mit dem CENTRAL-Kunstpreis im Kölnischen Kunstverein 2005. Nun ritt sie auf einem schwarzen Pferd in ihre Ausstellung, in der überwiegend Werke gezeigt wurden, die während ihres halbjährigen Preisaufenthaltes in Köln entstanden waren und dem Ausstellungsort und seiner Geschichte auf den Grund gingen.
Eine mediale Erweiterung, die ganz auf der Polarität von Materie und Immaterialität aufbaut, nahm sie dann 2010 im Portikus in Frankfurt vor. Große, schwere lehnende Marmorplatten waren unter anderem zusammen mit zwei voneinander getrennten Schwarz-Weiß-Fotografien von Landschaften und einer Projektion knapp über dem Boden ausgestellt. Die Interaktion von physikalischem und imaginiertem Raum, Realität und Vorstellung erweist sich als Konzept der existenziellen Selbstbefragung: Woraus besteht die Welt, können wir uns über sie eigentlich sicher sein? Dazu fertigt sie Skulpturen aus Stein (Kalkstein, Schiefer, unterschiedlicher Marmor), die, kompakt und zugleich bis zur Zerbrechlichkeit bearbeitet, mitten im Raum stehen oder eben als große flache Platten – und wie die Tür zu einer Schatzkammer – an der Wand lehnen und dazu teils mit unverständlichen, wie nachlässigen Einritzungen versehen sind. Mithin ließe sich sagen, dass der Stein eine lange Vergangenheit besitzt und die Genese der Erde repräsentiert, das Licht auf die Zukunft weist. Dass hier das Handwerk ist, dort das Spirituelle. Dass das massiv Konkrete auf das Ortlose und Unfassliche trifft.
Weitere Werke sind in Deutschland unter anderem auf der Berlin Biennale, der documenta und 2015-16 bei Julia Stoschek in Düsseldorf und wieder 2017, erneut ortsbezogen und teils fast zu übersehen, vertreten: Eine Tür öffnet sich nach draußen, Glocken läuten zu bestimmten Zeiten. 2017 wurde sie im Rheinland mit einem weiteren Preis ausgezeichnet, dem Wolfgang-Hahn-Preis in Köln. Im AC-Saal im Untergeschoss des Museum Ludwig bestand die Installation neben lehnenden flachen Steinplatten aus zwei Projektionen abstrakter Filme – Donnelly spricht von „Movies“ –, die durch die Kippstellungen der Beamer räumlich zu erfahren waren. Zu sehen waren abstrakte grüne bzw. blaue Formen und Schlieren, die subtil aber ununterbrochen in Bewegung schienen, Transparenz und Opazität, Raum und Fläche verschränkten. „Tatsächlich entstehen […] die Videoarbeiten in einem aufwendigen Prozess, bei dem das Ausgangsbild am Computer häufig digital bearbeitet, ausgedruckt, manuell verändert, eingescannt, überbelichtet, wieder digital bearbeitet wird, bis Donnelly es durch diese vielen analogen und digitalen Mutationen zur letztendlichen entschiedenen Form bringt.“ (Museum Ludwig, Beschlussvorlage einer Schenkung im Kulturausschuss der Stadt Köln) Was von dort in Erinnerung blieb: Flackerndes Licht, in dem ganze Filme kondensiert sind, Bilder entschwunden sind und sich als mögliche Erinnerungsfetzen zeigen. In seiner Intensität unvergesslich, wenngleich nicht fassbar.
Und nun, etliche Jahre später, erneut in Frankfurt, nun in der Außenstelle des MMK am Taunustor. Dass das Museum derzeit dorthin ausweichen muss, ist für dieses Werk wahrscheinlich ein Gewinn. Der große weiße Raum auf der zweiten Etage (oder ist es die gesamte zweite Etage?) des TaunusTurms ist eindrucksvoll – oder ist er eindrucksvoll, weil die Werke von Trisha Donnelly, so wie sie platziert sind und interagieren, ihn so wirken lassen? Auch jetzt finden sich, äußerst vereinzelt, an den Wänden Projektionen von Dias mit Überblendungen und weiteren Bearbeitungen sowie Abbildungen von Negativen, bis hin zu einer Kenntlichkeit, die genauso rätselhaft, offen für intuitive Bedeutungsebenen bleibt. An einem Ende des Raumes befindet sich außerdem eine durchgehbare Installation, wo vielleicht nicht jeder hingeht oder hochschaut: eine Laube aus Geflecht (Waldkiefer, Leyland-Zypresse) – einerseits im oberen Bereich der technisch funktionalen Wand zusammengerafft, andererseits wuchernd über den Köpfen mit Blick nach draußen auf die Straße.
Vor allem aber sind es die großen Gesteinsbrocken, die den Charakter der Ausstellung kennzeichnen, ihre räumliche Weite offenbaren und die Laufwege bestimmen. Sie stehen, ruhen hier ausschließlich im Raum und sind von allen Seiten sichtbar, ja, fordern in ihren teils kippenden Ausrichtungen noch zur Umgehung auf. Die materiellen Oberflächen und der Zugriff auf diese wechseln, die Farbklänge und die Restspuren der ursprünglichen Natur, die den Stein geformt und die Maserungen erzeugt hat. Unklar ist mitunter, was natürlich entstanden und was mit technischem Werkzeug bearbeitet wurde. Teilweise sind zahlreiche Zuschnitte und Einschnitte gefräst, die geometrische Ordnungen und Strukturen erzeugen und sich durch den ganzen Block ziehen und diesen parzellieren, so dass es an einzelnen Stellen vielleicht wirkt, als könnte der Stein auseinanderfallen.
Zu denken wäre an das Bildhauersymposion St. Margareten im Burgenland, das von Karl Prantl auf Meditation und Introspektion mit Respekt gegenüber den Steinen und ihren Strukturen – als Schaffensprozess im Dialog mit dem uralten Gestein – ausgerichtet wurde, oder, ganz in der Nähe, an den Steinbruch in Lindabrunn in Niederösterreich, wo Mathias Hietz das Schlagen und Zuschneiden des Steins in handwerklicher Arbeit als Form der Kultur und des Gemeinsinnes betont hat – aber das alles wäre in Bezug auf Trisha Donnelly ein Missverständnis. Ihr Ansatz ist konzeptuell, auch wenn die Skulpturen physisch sind und den Menschen als Betrachtenden und Handelnden mitdenken, die Höhe gerade so gewählt ist, dass er nicht die Oberseite sehen kann und schlicht und ergreifend es so ist, dass nie alle Seiten gleichzeitig zu sehen und dass alle verschieden sind. Dabei wechselt mit jedem Werk, schon der Gesteinsart, die Struktur und die Anmutung. Ein Werk ist so bearbeitet, dass es mit seinen tiefen flächigen Graten an Partien aus einem architektonischen oder technischen Kontext erinnert. Es ist merkwürdig: Die Gesteine wirken zugleich vertraut und fremd, anwesend und, trotz allem, wie abwesend, einer anderen Sphäre zugehörig. Vielleicht sind sie schön. Beim Presserundgang – so wurde berichtet – hat Trisha Donnelly weitere Lesarten geliefert, die auf den Evolutionsprozess der Natur hinweisen und Marmor als „pressed atmosphere“ verstehen, und angemerkt, dass sie die Steine in einer Werkstatt für Grabsteine in Italien gefunden hat. Alles öffnet sich, ist verbindlich und doch subjektiv verstehbar, löst Impulse der eigenen Vergegenwärtigung und Erinnerung aus. Diese Werke sind Erfahrungen des Denkens und Empfindens. Wunderbar!
Bis 22. März im Tower des Museums für Moderne Kunst (MMK), TaunusTurm, Taunustor 1 in Frankfurt a.M., www.mmk.art
Außerdem ist Trisha Donnelly beteiligt bei: „Incarnate“, Werke aus der Julia Stoschek Foundation und der Langen Foundation, 9.11.-22.3.26 in der Langen Foundation, Raketenstation Hombroich, Neuss
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Gino Bühler
Sensationen am Wegrand
Erde, Wasser, Luft und Feuer
„Das fünfte Element“ im Kunstpalast
Zeugnisse aus Fernost
Udo Dziersk in Hilden
Erika Kiffl
Das Atelier durchmessen
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„MITGIFT“, 2025 von Tayyib Sen
Ingrid Wiener
Das Leben in der Kunst
Stadt der Fotografinnen
„Perspektivwechsel“ im Stadtmuseum
Wände ohne Bilder
Hans-Peter Feldmann im Kunstpaalast
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
Anna Schlüters Blick auf „SELBSTPORTAIT MIT ADLERTATTOO“, Diptychon 2025 von Felix Giesen
Simon Schubert – Lichtlinien
Ausstellung der Brunhilde Moll Stiftung 12.10.25 - 31.1.26
Theater und Konzert im Dialog: DER GARTEN
5. Oktober 2025 im TEMPLUM Düsseldorf
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„ESP 06“, 2022 von Corina GERTZ
Lorenzo Pompa
Formen der Figur
Einfache Situationen
Reiner Ruthenbeck in der Skulpturenhalle bei Neuss
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
WAS BLEIBT…? 2025 von Laura Maria Görner
K.U. Wagenbach
Material als Sprache
Von Düsseldorf in die Welt
Wim Wenders in der Bundeskunsthalle Bonn
Die Stunde der Sammler
Die Sammlung Miettinen in der Philara Collection in Flingern
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
SEE YOU DOWN BELOW THE SNOW MOUNTAIN von Ana Korkia
Albrecht Fuchs
Eins mit dem Raum
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
REMIX 1, 2025 von Michael Schmidtmann
Charity Ausstellung Düsseldorfer KünstlerInnen
Vom 26.6. bis 13.7. im Weltkunstzimmer
Miriam Vlaming
Traumwandlerische Abwesenheit
Mensch im Leben
Thomas Schütte in Venedig und Hürth