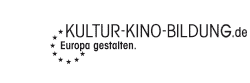Lorenzo Pompa
Formen der Figur
Ein Motiv, das sich konstant – und in hoher Intensität – im Werk von Lorenzo Pompa findet, ist der Kaktus, der ebenso als Gurke gesehen werden kann. So oder so sind die Naturgewächse kunsthistorisch relativ unbelastet. Als Kaktus ist es mehr ein Ding der Populärkultur, bei dem sogleich Wüste, Dürre, Wildwest und Einsamkeit evoziert sind. In Pompas Kunst ist er oft ausschließlicher Protagonist im Rahmen eines streng konzentrierten, formal regelrecht durchdeklinierten Vokabulars. Der Kaktus ist hier organisch und technoid zugleich, brodelnd lebendig und dann wieder still, genügsam und widerstandsfähig. In seinem Kanon ist er plastisch empfinden, sanft gewölbt, berechenbar auf seiner abgewandten Seite auch in den Malereien und Zeichnungen, und immer auf dem Sprung zur Figur. Peter Schüller versteht Lorenzo Pompa zu recht als Bildhauer: „Die Skulptur wird als Gegenüber des Körpers mit all seinen Wahrnehmungsmöglichkeiten für Dinge, Zumutungen und Anregungspotenzialen erlebt.“ (Kat. Krefelder Kunstverein 2020) Pompa hat einzelne Gurken in aufgehäuftes Salz gesteckt und ihnen so die Flüssigkeit entzogen. Die Gurken trocknen aus, ziehen sich zusammen und schrumpfen und bleiben, mit dem weißen Salz wie einem Fundament, unter einem Glassturz geschützt: als Schauobjekt und Versuchsanordnung. Als dunkel changierende, wenig ausbuchtende, dünne Stelen erinnern sie vordergründig an Alberto Giacometti und tiefgründig an Thomas Lehnerer und zeigen vor allem, dass hinter den Metamorphosen zum abstrakt Surrealen hin immer ein existenzieller Kern steckt, der nach dem Individuum und den Bedingungen des Lebens fragt.
Seit den frühen 2000er Jahren entstehen die Malereien mit dem Kaktus beziehungsweise der Gurke als Sujet. Die Formen stehen auf der Leinwand bilddominant in Ausschließlichkeit, sie treten prall und üppig auf. In den ersten Jahren tragen sie die Lokalfarben – also vor allem Grün –, später werden sie pastellfarben bunt, bleiben aber zart und der Natur verbunden. Die Kakteen befinden sich in einem leeren, umso mehr als weite Landschaft konnotierten Bildraum. Dann wieder sind sie im Bildausschnitt wie auf einer Bühne dicht zusammengedrängt, ragen versetzt voreinander auf oder wenden sich einander zu und liegen sogar auf der Erde und erwecken insgesamt den Eindruck einer höchst vitalen, von kleinen Geschehnissen und formalen Auslotungen erfüllten Oase. Einzelne Glieder hängen weich in einer gerüstartigen Konstruktion. Einerseits sind sie als Individuum an der Anatomie des Menschen orientiert, andererseits repräsentieren sie eine materielle Standardisierung. Die Kanneluren mit ihren tiefen Schatten tragen dazu bei, dass die Gewächse wie kantige Säulen antiker oder stattdessen postmoderner, gar futuristischer Architektur wirken. Zugleich tritt der Mensch in fragmentarischen Teilen collagiert in das Bild ein. An die Einbuchtungen der biomorphen Röhren zur Mundform schließen Lippen an. Zähne wachsen heraus, diese verwandeln sich in anderen Gemälden in ein Auge. Die vom Stamm sich verzweigenden Glieder werden zu Armen, und seit einigen Jahren bilden sich daraus erst recht Figurationen, die in Handlungen begriffen sind, die Züge der Interaktion, des Dialogischen, aber auch Feindseligen besitzen. Unterschwellig klingt Gewalt an, finden sich Gesten der Aggression und zugleich zeigen diese Bilder Schönheit, Eleganz und Verspieltheit. Sind sie Stillleben, Genreszene oder, in der atmosphärischen Anmutung, doch Metapher einer Pastorale, die aber noch ganz anderes mitteilt?
„Arrows“ (2019) ist derzeit im Kunstmuseum Ratingen ausgestellt. Zunächst verursachen die Fülle und die Vielzahl räumlicher Ebenen Unruhe. Der Hintergrund ist weitgehend von den biomorphen Geschöpfen überdeckt. Hinzu kommt eine ausgeschnittene olivgrüne Fläche, deren Teile wie Bühnenaufzüge zwischen den Figurationen platziert sind. Als weiteres Motiv, das hier einseitig ausgerichtet ist, kommen farbige Hinweispfeile hinzu. Die Darstellung scheint wie auf einem Bildschirm virtuell, artifiziell konstruiert, nicht recht zu fassen, ohnehin ein vorübergehender Zustand. Frontal ist ein breites Gebiss zu sehen wie von einem Pferd im Comic, zugleich ist es isoliert und dazu mit Farbstreifen umrandet. Links und rechts davon ist jeweils ein Auge als Glasmurmel in die Einbuchtung eines Stammes eingelagert. Über dem Gebiss schwebt eine Säule, zwei Glieder drum herum sind aufgeschnitten, so dass aufgewühlte blutrote Flächen zu sehen sind. Die Kakteen selbst verjüngen und erweitern sich, knicken ab und verzweigen sich. Als Figuren schildern sie menschliche Dramen des Miteinander und Gegeneinander. Lorenzo Pompa hat derartige Konstellationen des Theatralischen und des Grotesken, das Ereignisse unseres Lebens in einer eigenen Bildsprache komprimiert, variiert und weitergeführt. Zugleich handelt es sich um eine Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Malerei, ihrem Illusionscharakter, ihrer Expressivität und Introvertiertheit und der Befähigung, den Duktus und damit die Atmosphäre plötzlich zu wechseln. Von Mal zu Mal fließen kunsthistorische Zitate ein, etwa zu Philip Guston oder Dalí, aber auch zur italienischen Renaissance. Zunehmend erhalten die Grate und Rillen, die sich zu prismatisch anmutenden Streifen erweitern, eine massive Stofflichkeit, die zwischen Metall, Stein und textilem Überzug wechselt – so wie sie auch an die Falten eines schweren samtenen Vorhangs erinnern kann.
Lorenzo Pompa wurde 1962 in Krefeld geboren, seit seinem Studium lebt er in Düsseldorf. Er stammt aus einer italienischen Künstlerfamilie, sein Vater Gaetano war Maler und sein Bruder Adriano ist Maler und Bildhauer: Zusammen haben sie 2002 in der Galerie von Horst Schuler in Düsseldorf ausgestellt. Er ist in Rom aufgewachsen und hat dort Interieur Design studiert. Anschließend ist er nach Düsseldorf gewechselt und hat zunächst Architektur an der Fachhochschule und dann Freie Kunst an der Kunstakademie studiert und als Meisterschüler in der Bildhauerklasse von Georg Herold abgeschlossen.
Bekannt geworden ist Lorenzo Pompa mit bildfüllenden abstrakt-konkreten Ordnungen überwiegend aus Schwarzfarben, die in ihrer „Knoten für Knoten“ „gestrichelten“ Linearität vordergründig an Teppichmuster erinnern. Breite Bahnen oder Reihen von Linien und Lamellen schließen wie Holzbretter aneinander an und umlagern sich, stoßen als gerichtetes Binnengeschehen schräg aufeinander, wirken schwer und statisch und vibrieren in ihren feinen, minutiösen Konturierungen. Opulenz trifft sich mit dem Hingebungsvollen, mit dem die Werke durchdacht und zusammengesetzt sind, so dass sich der Blick in ihnen verwirrt. Und trotzdem, in ihrer minutiösen Konstruiertheit sind sie Exerzitien zur Meditation – für den Künstler wie auch den Betrachter. Bis heute setzt Pompa diese Werkgruppe fort und findet immer neue motivische Referenzen, etwa an Flaggen, so wie sie das Steife der Kakteen begleiten. Die einzelnen Bildfelder in einem Gemälde sind mitunter unterschiedlich behandelt und dunkel, teils so, dass sie mit dem Wechsel der Perspektive verschwinden oder erst recht hervortreten. Ohnehin klappen die Bilder visuell von der Fläche in den Raum und entwickeln mit ihren Parallelführungen eine sogartige Tiefe. Aber sie enthalten vereinzelt auch Verläufe, die, umfangen von Schattierungen, bereits Spuren anekdotischer Ereignisse oder von Landschaft aufweisen.
Lorenzo Pompa hat derartige Tafeln ebenso in den Realraum gestellt, etwa in Installationen und Musik-Performances, die er mit dem Komponisten Mark Sabat auf den Donaueschinger Musiktagen 2007 und in der Akademie der Künste Berlin 2010 aufgeführt hat. Vielleicht sollte man Lorenzo Pompa immer auch als Installationskünstler verstehen, der die Dinge zueinander arrangiert und untersucht, wie sie sich zueinander verhalten und eine Tiefe produzieren. Wie sie selbst in der Malerei geradezu allansichtig werden. In der Van der Grinten Galerie in Köln hat Pompa seine Malereien und Skulpturen so angeordnet, dass die drei Räume unterschiedliche Temperierungen tragen. Der erste Raum wird von dem violett gebrochenen Rot der hier ausgestellten Bilder dominiert, die mit dem Potenzial einer dystopisch gedimmten Atmosphäre auftreten und von unten nach oben Farbsäulen fließen lassen. Und dann steht das größte der Gemälde – „Cortez“ (2025) – mitten im Weg zum zweiten Raum, der sich den plastischen Arbeiten widmet. Folglich kann man von dort die Rückseite als Konstruktion sehen, die zugleich jeden Schimmer an räumlicher Illusion ad absurdum führt und mitteilt, dass wir es hier eben doch mit dem Auftrag von Farbe auf einer Fläche zu tun haben. Aber der Titel auf der Rückseite hebt das Geschehnis ins Anspielungsreiche, indem es sich um den spanischen Eroberer des Aztekenreiches im 16. Jahrhundert handelt. Der Ton der Vereinnahmung und die aufwachsenden Kabinen mit den technoiden Eingriffen in eine bergige Landschaft liegen bleiern über der Darstellung.
So eigenwillig und konsequent wie die Malereien sind, so eindrucksvoll sind die Skulpturen: In Weiß und in menschlicher Höhe und ohne weiter bestimmt zu sein, verfügen sie über eine massige figürliche Präsenz, aus der heraus sie prall gefüllt scheinen, sich amorph ausbreiten und teils kantig beschnitten sind und so das Deformierte steigern. Extremitäten sind allenfalls angedeutet, hingegen finden sich Momente der Krümmung. Zum Lebendigen und der sinnlichen Empfindung trägt die Oberfläche bei, die aus Gips, glasierter Keramik oder Aluminiumguss besteht. In der Van der Grinten Galerie ist auch eine von Pompas „Masks“ ausgestellt. Diese bestehen, eingefügt in ein Gestell, aus weißen voluminös blockhaften Formen, die erneut an Zähne denken lassen und in halbrunder Anordnung nebeneinandersitzen, so dass sie mit ihren Dimensionen um den Kopf passen könnten. Selbst die Wucht dieser Formen offenbart eine Sensibilität, die direkt auf den Menschen und das Leben verweist. Mit der gewichtigen, höchst kalkulierten Leichtigkeit seines gesamten Werkes greift Pompa tief ein ins Unterbewusstsein. Natürlich handelt es sich um die Schelme und Monster unserer Träume, kaum im physischen Sinne, vielmehr in Bezug auf die psychische Verfasstheit. Oder ist nicht doch alles ganz anders?
Bis 25. Oktober in der Van der Grinten Galerie, Gertrudenstraße 29 in Köln. Außerdem ist Lorenzo Pompa beteiligt bei: „REMIX“, bis 11. Januar im Museum Ratingen, und führt dort am 16.11. in italienischer Sprache durch die Ausstellung: Peter-Brüning-Platz in Ratingen.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Gino Bühler
Sensationen am Wegrand
Erde, Wasser, Luft und Feuer
„Das fünfte Element“ im Kunstpalast
Zeugnisse aus Fernost
Udo Dziersk in Hilden
Erika Kiffl
Das Atelier durchmessen
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„MITGIFT“, 2025 von Tayyib Sen
Ingrid Wiener
Das Leben in der Kunst
Stadt der Fotografinnen
„Perspektivwechsel“ im Stadtmuseum
Trisha Donnelly
Konzentrate der Wahrnehmung
Wände ohne Bilder
Hans-Peter Feldmann im Kunstpaalast
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
Anna Schlüters Blick auf „SELBSTPORTAIT MIT ADLERTATTOO“, Diptychon 2025 von Felix Giesen
Simon Schubert – Lichtlinien
Ausstellung der Brunhilde Moll Stiftung 12.10.25 - 31.1.26
Theater und Konzert im Dialog: DER GARTEN
5. Oktober 2025 im TEMPLUM Düsseldorf
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„ESP 06“, 2022 von Corina GERTZ
Einfache Situationen
Reiner Ruthenbeck in der Skulpturenhalle bei Neuss
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
WAS BLEIBT…? 2025 von Laura Maria Görner
K.U. Wagenbach
Material als Sprache
Von Düsseldorf in die Welt
Wim Wenders in der Bundeskunsthalle Bonn
Die Stunde der Sammler
Die Sammlung Miettinen in der Philara Collection in Flingern
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
SEE YOU DOWN BELOW THE SNOW MOUNTAIN von Ana Korkia
Albrecht Fuchs
Eins mit dem Raum
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
REMIX 1, 2025 von Michael Schmidtmann
Charity Ausstellung Düsseldorfer KünstlerInnen
Vom 26.6. bis 13.7. im Weltkunstzimmer
Miriam Vlaming
Traumwandlerische Abwesenheit
Mensch im Leben
Thomas Schütte in Venedig und Hürth