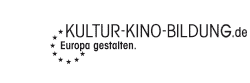K.U. Wagenbach
Material als Sprache
Die Natur ist ein idealer Ort. Umgeben und überwuchert von Bäumen und Gebüsch wirken die abstrakten Steinskulpturen von K.U. Wagenbach hier erst recht introvertiert, lakonisch in ihrer Symbolik und sinnlich mit ihrer Oberflächentextur und ihrem changierenden Ton. Eine Werkmonographie, die er vor drei Jahren veröffentlicht hat, nähert sich den Skulpturen aus einer anderen, die Formen dokumentierenden Perspektive, jeweils für sich vor einem neutralen hellen Verlauf. Der Untertitel „Album I“ signalisiert eine relative Vollständigkeit mit Werken aus drei Jahrzehnten und der Erkenntnis, dass eins aus dem anderen hervorgeht. Angesprochen sind mit dieser Buchform aber auch Erinnerung und deren Bewahrung. Weiterhin impliziert das System eines Albums Annäherung hin zur Privatheit und das Neujustieren der Wahrnehmung mit dem Wissen um das Frühere wie auch Spätere und die eigene Distanznahme. Dazu passt der Titel des Buches selbst: „Fremde“ – so heißt noch eine Stele aus Granit, die als Schaft im unteren Abschluss wie ein Keil in einen kantigen Block eingefügt und im oberen Bereich zylindrisch ummantelt ist. Auch wenn K.U. Wagenbach das nicht überbewertet wissen möchte, so liefern die Werktitel doch Hinweise zu einem möglichen Verständnis: Eremit, Exil, Beobachter – sämtlich Stelen – oder Mephisto, Quelle, Transit – blockhafte, teils durchbrochene Skulpturen – oder Pietà, Le Petit Philosophie, die auch weiterhin abstrakt sind, aber durch ihre Titel eine verborgene Figürlichkeit bestätigen.
Das gilt auch für seinen „Angelus Novus“ (2008). Der Titel ist von der aquarellierten Zeichnung von Paul Klee übernommen, die als Menetekel zur NS-Diktatur zu verstehen ist und die Walter Benjamin auf Stationen seiner Flucht begleitet hat. Wagenbach hat seine gleichnamige Skulptur mit dem reichen technischen Repertoire des Bildhauers – zwischen Abschlagen und nuancierter Oberflächenbehandlung – aus Marmor geschaffen. Ihre Erscheinung verhält sich zwischen Torso und Mandorla, sie evoziert einen Kopf und vielleicht sogar eine Ganzfigur aus Graten und Furchen in der aufgeschürften hellen Oberfläche, in die kreisrunde Vertiefungen mit eigenen Formereignissen eingelassen sind. Die Skulptur scheint in fragiler Aufwühlung zu pulsieren. Der Stein wird zur fast durchsichtigen Membrane.
K.U. Wagenbach veranschaulicht hier und in weiteren seiner Skulpturen eine geistige Verfasstheit in Verbindung mit existenzieller Zuschreibung. Die Resilienz der Steine geht mit einem vorsichtigen Ertasten der Welt einher, welche die Skulptur umgibt. Mitunter öffnet K.U. Wagenbach die Oberfläche. Innen und außen sind verschränkt, etwa wenn unterhalb einer breiten „Haut“ der Stein aufgerissen und expressiv wirkt, sich Bandformen umeinander legen oder Röhren und konische Formen zueinander gesetzt sind. Die Spannungen des Volumens wechseln teils in ein weiches Abflauen. Die Skulpturen sind organisch und anthropomorph ebenso wie sie konstruktiv und von der Geometrie abgeleitet sein können. Zwar erweist sich der Stein für die elementaren Erkundungen als geeignetes, aber nicht ausschließliches Material. Wagenbach arbeitet auch mit Zinn, Kupfer, Messing, Eisen, Bronze oder Bakelit, oft als präfabrizierte Fundstücke, die er miteinander kombiniert, zueinander collagiert oder aufeinanderschichtet. Im Freien setzt sie er sie der Verwitterung, der Korrosion oder dem Überzug von Pilzkulturen aus. Einzelne Skulpturen besitzen Teile aus Holz und bestehen sogar aus Baumstämmen. Für Wandarbeiten verwendet er Vlies und Filz. Daneben hat er Prägedrucke in der entsprechenden Formsprache hergestellt: Im ausgiebigen Hinsehen werden Ränder und Binnenkanten sichtbar, die ein Relief erzeugen. Die Grate in der weißen Fläche führen – auch in diesem Medium – zur Modellierung von Licht und Schatten.
Die Steine wiederum sind Basalt, Granit und Marmor, Muschelkalk, Schiefer oder Sandstein. Wieder zurückgeführt in die Naturlandschaft und dort sich überlassen, demonstrieren sie Zeitlosigkeit mit den Spuren der Zeit, indem sich die Witterung an ihnen festsetzt und sich vielleicht Rinnsale für einen Weg des Regens bilden. – Vor Ort ist es etwas überraschend, wie nach der Zufahrt, die umgeben von Gebüsch plötzlich vom Südring abzweigt, mehrere flache Gebäude in der dichten Landschaft aufeinander folgen, mit dem Bildhaueratelier am Ende des Geländes, auf dem er seit 2007 arbeitet und das er ab 2012 ausgebaut hat. K.U. Wagenbach spricht von Off Spaces im „Kulturlabor“. Hier finden seit 2016 kulturelle Veranstaltungen statt, darunter zeitweilig die „City Noise“-Veranstaltungsreihe, neben Ausstellungen auch Lesungen sowie Tanz, Ende August unter der Choreographie von Pascal Touzeau. Es ist ein Jammer, dass das alles hier raus soll, weil für das Gelände ein neuer Zweck vorgesehen ist.
K.U. Wagenbach gehört hierzulande mit Sicherheit zu den interessantesten Bildhauern mit dem Material Stein. Weil Stein als autonomer künstlerischer Werkstoff derzeit eher wenig gefragt ist und er hier eigentlich noch nicht so lange ansässig ist, wird er in Düsseldorf wohl ein Geheimtipp sein. Geboren 1966 in Limburg, ist Wagenbach in Neuss aufgewachsen. Ab 1984 hat er Schauspiel am Max Reinhardt Seminar in Wien studiert. Erst danach hat er sich für die Bildende Kunst entschieden. 1989 und 1991 hat er an der Sommerakademie der HdK die Klasse von Raffael Rheinsberg besucht, die auf Spurensuche und Land Art hin ausgerichtet war, und währenddessen und danach in einem Betrieb für Orgelbau in Limburg gearbeitet, wo er das tiefere Gespür für Metall entwickelt haben könnte ebenso wie für zylindrische und konische Formen, deren Ordnung und Unordnung, die sich aber doch austariert. 1993-95 hat er eine Ausbildung bei dem Steinbildhauer Stefan Behrends in Hamburg absolviert und danach bis 2006 in Pietrasanta in der Nachbarschaft der Marmorbrüche von Carrara gearbeitet. K.U. Wagenbach schwärmt von den professionellen Arbeitsbedingungen, die er dort vorgefunden hat, in denen er den Steinblock als gleichberechtigtes Gegenüber auf Augenhöhe erfahren konnte. Vieles davon findet sich nun auch in seinem „Skulpturlabor“ wieder. Inmitten der wuchernden Landschaft legt er mit den Händen unbearbeitete Steine auf der Erde frei, hebt sie leicht an, streicht über sie und sucht die richtige Perspektive für die Betrachtung. Er spricht von der Sprache des Materials. Der Mensch bleibt Referenz mit seinen Maßen, seiner Beweglichkeit und seinen Gesten, auch im Zwiespalt von Natur und Zivilisation. So hat er Zelt-Plastiken mit Planen oder farbigen Stoffnetzen entwickelt, die betretbar und im Inneren erhellt sind und deren Konstruktion aus Metallrohren im geometrischen Kontrast angelegt ist. Andere Skulpturen erinnern an Platzanlagen, als Entwürfe, die etwa ein Wasserspiel berücksichtigen. Ihre Mehrteiligkeit erzeugt dialogische Situationen. Die konkrete Ausformulierung wird durch sanfte organische Partien vitalisiert, die den Menschen mitdenken. Der Rückzug auf das plastisch-skulpturale Arbeiten, insbesondere die Steinbildhauerei, und die gleichzeitige rege kulturelle Aktivität schließen sich gerade nicht aus. Stilles Beobachten und extrovertiertes Handeln bilden als engagierte Teilhabe an der Gegenwart eine Einheit.
K.U. Wagenbach ist beteiligt bei den Kunstpunkten, gemeinsam mit Udo Bechmann und Nico Mares: Kunstpunkt 89, am 13. und 14. September im Skulpturlabor am Südring 135, www.klaus-wagenbach.de
Außerdem dort im Kulturlabor: 4. Oktober Micropop-Festival: The Rocket in Dub
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Das eigene Hab und Gut
„Grund und Boden“ in K21
Nina Fandler
Von Bild zu Bild
Linie Fläche Raum – 100 Jahre Museum Ratingen.
Jubiläumsausstellung zur Kunstsammlung und Architektur vom 13. März bis 16. August
Gino Bühler
Sensationen am Wegrand
Erde, Wasser, Luft und Feuer
„Das fünfte Element“ im Kunstpalast
Zeugnisse aus Fernost
Udo Dziersk in Hilden
Erika Kiffl
Das Atelier durchmessen
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„MITGIFT“, 2025 von Tayyib Sen
Ingrid Wiener
Das Leben in der Kunst
Stadt der Fotografinnen
„Perspektivwechsel“ im Stadtmuseum
Trisha Donnelly
Konzentrate der Wahrnehmung
Wände ohne Bilder
Hans-Peter Feldmann im Kunstpaalast
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
Anna Schlüters Blick auf „SELBSTPORTAIT MIT ADLERTATTOO“, Diptychon 2025 von Felix Giesen
Simon Schubert – Lichtlinien
Ausstellung der Brunhilde Moll Stiftung 12.10.25 - 31.1.26
Theater und Konzert im Dialog: DER GARTEN
5. Oktober 2025 im TEMPLUM Düsseldorf
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„ESP 06“, 2022 von Corina GERTZ
Lorenzo Pompa
Formen der Figur
Einfache Situationen
Reiner Ruthenbeck in der Skulpturenhalle bei Neuss
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
WAS BLEIBT…? 2025 von Laura Maria Görner
Von Düsseldorf in die Welt
Wim Wenders in der Bundeskunsthalle Bonn
Die Stunde der Sammler
Die Sammlung Miettinen in der Philara Collection in Flingern
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
SEE YOU DOWN BELOW THE SNOW MOUNTAIN von Ana Korkia
Albrecht Fuchs
Eins mit dem Raum
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
REMIX 1, 2025 von Michael Schmidtmann