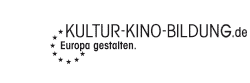Ilse Henin
Erzählungen vom Leben, vom Umgang der Lebewesen miteinander und von der Einrichtung in der Welt
Ilse Henin nahm die Komplimente bei der Vorbesichtigung gelassen entgegen. Innerhalb der aktuellen Gruppenausstellung in der Kunsthalle am Grabbeplatz wird sie im Seitenlichtsaal mit einer ausgiebigen Einzelausstellung gewürdigt, die außerdem die Impulse für die weiteren Beiträge in Kino- und Emporen-Saal vorgibt. Ihre erste exponierte institutionelle Einzelausstellung war ja überfällig: mit ihrer künstlerischen Konstanz über fünf Jahrzehnte und ihren autobiographisch fundierten Themen des Feminismus und der Bewahrung der Schöpfung, die um häusliches Leben und um zwischenmenschliche Kommunikation, mentale Konflikte und physische Fragilität, Identität und Heimat kreisen, und das ausgesprochen pointiert, reduziert, überwiegend mit den Mitteln der Linie, verwirklicht aus der Bewegung der Hand heraus. Seit einigen Jahren wird sie von der Galerie KM in Berlin vertreten; Gregor Jansen hat ihre Bilder in deren Messekoje auf der Art Cologne entdeckt.
Der Auftritt nun in Düsseldorf ist auch deshalb passend, weil sie hier zeitweilig wohnt. Der Ausstellungstitel „Die unhintergehbare Verflechtung aller Leben“ bringt ihr Werk auf den Punkt. Sie erhebt das Miteinander zum Prinzip. Die Kontaktaufnahme findet frontal zum Publikum statt und damit in die konkrete Wirklichkeit hinein oder im Profil zu anderen Figuren, Wesen. Die meist farbige Linie wird zur tastenden Aneignung der Umgebung, ein Abgrenzen auch, das aber durchlässig ist. Innenwelt und äußere Umgebung interagieren miteinander. So ist auch ihr Werk gegenständlich zu lesen, dabei nie ganz zu entschlüsseln, surreal aufgeladen mit Träumen ebenso wie vom Alltag umfangen und von erstaunlichen oder banalen Begegnungen vollgesogen.
Ilse Henin wurde 1944 in Köln geboren, 1966-1970 hat sie an der Kunstakademie Karlsruhe bei dem Bildhauer H.E. Kalinowski studiert, der sie zeichnen ließ. In etwa zeitgleich studieren hier auch Helmut Schweizer und Sylvia Wieczorek, die ebenfalls später nach Düsseldorf ziehen. In der Karlsruher Kunstszene wird sie noch die Ausläufer der Neuen Figuration – als Zeitstil, der hier einen Ursprung hatte – mitbekommen haben mit Künstlern wie Horst Antes, Walter Stöhrer und Hans Baschang und der teilweisen Wendung Richtung Pop Art. Frauen spielen als Künstler in diesen Jahren kaum eine Rolle. Sie erlebt die Politisierung der Gesellschaft. Kunst wird öffentlich, sei es durch die Jahresgaben der Kunstvereine als demokratische Multiplikatoren, sei es durch Straßenaktionen. Kontext sind die Antiatomkraft-Bewegung und die Proteste gegen den Vietnam-Krieg. Im Anschluss an das Studium zieht sie nach Düsseldorf und gründet hier mit ihrem Mann Hans Henin, der bei Beuys studiert hat und zu Akademiezeiten Mitglied der Gruppe YIUP war, ihre Familie. In den Jahren ab 1970 nimmt sie noch am „Neumarkt der Künste“ in Köln teil, ehe ihre künstlerische Arbeit vorübergehend zum Stillstand kommt. – Ilse Henin wird im Pressegespräch in der Kunsthalle energisch: Dass sie die Kunstausübung für über ein Jahrzehnt eingestellt habe, habe nichts mit Machtstrukturen im Kunstbetrieb zu tun gehabt, sondern schlicht damit, dass sie ihre Kinder großgezogen habe. Folglich war – und ist – Düsseldorf auch nicht der Ort für die eigene Kunstausübung. Stattdessen haben Hans Henin und sie hier, wo sich der Kunstbetrieb genau beobachten ließ, an der Berger Allee das „statt-museum“ als alternativen Ausstellungsraum gegründet. Ab 1998 beteiligt sie sich dort selbst mit Werken an Ausstellungen.
Nachdem sie lange Zeit sporadisch zeichnet, setzt sie dies seit etwa 2000 wieder kontinuierlich fort, und zwar in der kleinen Gemeinde Gamlen in der Eifel. Die Blattformate sind verhältnismäßig groß. Das Papier, auf dem sie – abgesehen von einigen frühen Bildern auf Leinwand – durchgehend zeichnet, ist als Grund, auf den der Stift auftrifft, widerständig. Sie arbeitet mit Pastellkreide und Ölkreide, Farbstift und Bleistift und Kugelschreiber. Die Arbeitsspuren mit Finger- und Fußabdrücken bleiben mitunter stehen. Als Bildträger verwendet sie ebenso getönte Kartons, auch den Innenraum kleiner Pappschachteln. In der Kunsthalle sind außerdem Zeichnungen auf einem Druckbogen und einer Zeitungsseite ausgestellt, die eben auf die vorgegebenen Informationen reagieren. Immer wieder zeichnet sie in Zeichenbücher, die fast zu ordentlich und korrekt im Ziehen, Verschränken und Anlehnen von Konturen sind, im Figürlichen und Schaffen surrealer Sachverhalte. Die Rückseiten von Briefumschlägen sind ins Hochformat gekippt, welches nun ganz von jeweils einer weiblichen Figur besetzt ist: in den Konturen schablonenhaft typisiert, zugleich immer wieder anders. Im Laufe der Jahrzehnte gewinnt die Linie an Rasanz, wird stabiler und perfekter in dem leeren, weißen Grund und initiiert so ein plastisches Volumen zwischen Fläche und Raum. Sie schlägt um, quert weitere Striche. Andere sind als mäanderndes Band in die Binnenform gelegt oder deuten eine Schraffur an.
Auf den großen Papieren bleibt die (weibliche) Gestalt das zentrale Sujet durch die Jahrzehnte. Teils ist sie auf den Kopf und das Gesicht mit seinen minimalen Einzeichnungen beschränkt. Die Figuren schauen sich an oder sie schauen aneinander vorbei; mitunter deuten sich Ordnungen an durch die Zentrierung oder verschiedene Größen, dann wieder scheint es als handle sich bei der Umgebung um schiere Kopfgeburten, also die Kombinatorik des Augenmenschen. Dazu kommen einzelne Tiere und Tierwesen. „Ich finde, dass das Leben wie ein Zirkus ist. Und jeder will gehört werden“, sagt Ilse Henin. Was aber sich zwischen den Personen ereigne, das sei doch das Wichtigste. Sie schildert Beziehungen zueinander, aber auch Rückzug und deutet eine Verbundenheit zur Natur und eine spirituelle Tiefe an, aus der Perspektive der Frau, die einmal – aber nur einmal – als Topos für das gebärende Wesen gegeben ist. Natürlich geht es insgesamt auch um das Spiel des Lebens, vorgetragen ganz unbeschwert, voller selbstbewusster Leichtigkeit und mit einem feinen Humor.
Die unhintergehbare Verflechtung aller Leben, bis 17. September in der Kunsthalle Düsseldorf am Grabbeplatz
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Zeugnisse aus Fernost
Udo Dziersk in Hilden
Erika Kiffl
Das Atelier durchmessen
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„MITGIFT“, 2025 von Tayyib Sen
Ingrid Wiener
Das Leben in der Kunst
Stadt der Fotografinnen
„Perspektivwechsel“ im Stadtmuseum
Trisha Donnelly
Konzentrate der Wahrnehmung
Wände ohne Bilder
Hans-Peter Feldmann im Kunstpaalast
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
Anna Schlüters Blick auf „SELBSTPORTAIT MIT ADLERTATTOO“, Diptychon 2025 von Felix Giesen
Simon Schubert – Lichtlinien
Ausstellung der Brunhilde Moll Stiftung 12.10.25 - 31.1.26
Theater und Konzert im Dialog: DER GARTEN
5. Oktober 2025 im TEMPLUM Düsseldorf
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„ESP 06“, 2022 von Corina GERTZ
Lorenzo Pompa
Formen der Figur
Einfache Situationen
Reiner Ruthenbeck in der Skulpturenhalle bei Neuss
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
WAS BLEIBT…? 2025 von Laura Maria Görner
K.U. Wagenbach
Material als Sprache
Von Düsseldorf in die Welt
Wim Wenders in der Bundeskunsthalle Bonn
Die Stunde der Sammler
Die Sammlung Miettinen in der Philara Collection in Flingern
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
SEE YOU DOWN BELOW THE SNOW MOUNTAIN von Ana Korkia
Albrecht Fuchs
Eins mit dem Raum
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
REMIX 1, 2025 von Michael Schmidtmann
Charity Ausstellung Düsseldorfer KünstlerInnen
Vom 26.6. bis 13.7. im Weltkunstzimmer
Miriam Vlaming
Traumwandlerische Abwesenheit
Mensch im Leben
Thomas Schütte in Venedig und Hürth
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
THE CRADLE, 2025 von Yuhan Ke