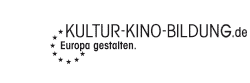Björn Knapp
Figur vor Grund
Wenn es in der zeitgenössischen Kunst um Malerei geht, schwingt unausgesprochen die Frage mit, ob diese uralte Disziplin noch aktuell ist und wie sie, im Rückspiegel ihre Tradition und ihre Meisterwerke und im Wissen um die digitalen Möglichkeiten, das Internet und dessen Weiterentwicklungen der Gegenwart überhaupt angemessen sein kann. Vermittelt sie bei aller Einzigartigkeit und Attraktivität in Bezug auf die heutige Zeit eine Informationsdichte und Erkenntnisgewinne und den Zweifel an einem überliefert geschlossenen Weltbild? Schließlich gibt es noch das Spektrum der Fotografie und der Fotocollage mit ihrer Haptik und Authentizität. Und macht es die Sache nicht ohnehin „klassisch“, wenn das zentrale Sujet der menschliche Körper ist, der heute per Klick im Verschwinden begriffen ist, zugleich sich entäußert und dem Hochglänzenden und Photoshop preisgegeben und sogar als 3-D-Scan verfügbar wird.
Alles das ist auf vielfältige Weise angesprochen in der Malerei von Björn Knapp, der jetzt bei Setareh seine erste Einzelausstellung erhält. Der Mensch ist bei ihm in seiner Leiblichkeit mit dem Inkarnat und organischen Formen und Farbflächen, die die Plastizität, sogar Torsion der Anlage im Bildfeld steigern, abzuleiten. So gibt es einzelne Bilder, bei denen eine Formkonstruktion aufrecht steht oder zwei graue und dadurch tiefliegende zugespitzte Partien nebeneinander und eine mit Abstand drunter die Erinnerung an einen Kopf wecken könnten. Und doch bleibt die Figur im Möglichkeits-Status: als etwas, das ungesichert ist und, im flächigen Hell-Dunkel mitunter wie im Gegenlicht, plötzlich andere, anders konnotierte Partien nach vorne rückt. Björn Knapps Malerei setzt sich, umgeben oder durchsetzt von einem (blauen) Grund, wie ein Mosaik aus abstrakten Formen zusammen, die sich umeinander legen und aufeinander stoßen, sogar aneinander gespiegelt sein können und sich im Komplementären, präzisen Nebeneinander der Farbflächen abgrenzen.
Die Vermutung liegt nahe, es hier mit einer Collage zu tun zu haben, bei der sich eins aus dem anderen kompositorisch aufbaut. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ausgangspunkt sind meist spontane Fotografien, die Björn Knapp überwiegend von Situationen im Stadtraum, in der Landschaft oder vom eigenen Körper, vom Knie etwa, aufgenommen hat – das passiert vereinzelt sogar unbeabsichtigt, etwa weil die Handykamera gerade nicht ausgeschaltet war. Die schließlich ausgewählten Aufnahmen durchlaufen mit analogen technischen Mitteln, zwischendurch ausgedruckt in Schwarz-Weiß, Stadien der ausgiebigen Beobachtung, der Fokussierung des Interesses und der Konzentration auf das für ihn Wesentliche. In der Hinwendung auf einzelne Details und Formabschnitte nimmt Björn Knapp Vergrößerungen vor, aber dann beginnt das Spiel der Auseinandersetzung mit den Vorgaben von neuem und führt etwa zum Drehen der Leinwand beim Malprozess. Einzelne Stadien hat er in Zeichnungen oder Collagen festgehalten, aber derartige Ergebnisse sind eher die Ausnahme.
Die Konzentrierung führt ihn zur Malerei großer abstrakter Binnenflächen, deren Umrisse noch dem Ausgangsfoto folgen, begleitet von der Einfügung weiterer Partien und manchmal auch kleineren Farbverläufen oder Flecken. Dabei beschränkt er sich auf wenige Farben, aus denen er alle weiteren mischt, die ein Leuchten mit dem gedämpft pastellfarbenen Ton verbinden oder das erdige Klima der Natur erzeugen. Also die Farbgebung ist Teil der Identität und führt bei vergleichbaren Formbeziehungen dazu, mehrere Bilder als Werkgruppe zusammenzufassen. Die Malhandlung selbst bleibt als nuancierter Farbauftrag erkennbar; frühere Zustände bleiben streckenweise, wenn man nahe herantritt, durch die Übermalungen hindurch sichtbar und deuten so die Geschichte des Bildes an. Ganz vereinzelt führt ein zum Sfumato vertriebenes Schwarz zur Wahrnehmung als Schatten und suggeriert eine Schichtung oder Bewegtheit der Oberfläche, steigert jedenfalls das räumliche Empfinden.
Und mit all dem und trotz der monolithischen Sachlichkeit der wenigen Formationen passiert eine Menge. Einzelne fast lineare Verläufe kehren an anderen Stellen im Bild wieder und leiten sozusagen durch dieses. Die organischen, teils auch ornamental schwellenden Flächen wirken mit ihrem Hautton sinnlich, lassen Körperlichkeit spüren, zelebrieren Ausdehnung und Intensität. Bei den kleineren Gemälden scheinen Erinnerungen an erogene Zonen auf. Andere Bilder vermitteln zwischen kargen Landschaften und Resten einer Figuration. Die Flächen, die unmittelbar aufeinander stoßen, verlaufen weich geschwungen, dabei versetzt, ausbuchtend. Und bei einem Gemälde wirkt das Nacheinander von Partien in Grau, in Karminrot und, auf der anderen Seite direkt vom Grau ummantelt, in hellem Blau wie die seitliche Durchsicht durch eine Felsformation auf den Himmel. Dabei handelt es sich in Verbindung mit dem weiteren Geschehen, das die Idee der Spiegelung als Schatten zu variieren scheint, doch immer um das Zueinander von Formen, das aus dem lapidar Geordneten heraus immer komplexer wird. Sobald sich Strukturen von Landschaft, Gestein oder Figur für das Verständnis anbieten, stellen sich neue Fragen. So ist der Ton für Haut, den Björn Knapp verwendet, nicht eindeutig einer Ethnie zuzuordnen und die organischen Formen lassen sich nicht auf ein Geschlecht reduzieren. Ohnehin behaupten die Fragmentierungen Individualität, indem sie noch auf jeden Kontext und jede Zuordnung verzichten; Zeit ist hier sowieso abwesend. Der Reiz liegt in der Offenheit der Bedeutung: Referenzen stellen sich ein, Repräsentanzen nicht. Und dann, im Wechsel der Perspektive und der Annäherung des Betrachters schon von der Seite wirken die Bilder ganz anders, treten andere, zuvor übersehene Partien regelrecht in den Vordergrund. Das vertrackte Verhältnis von Vorne und Hinten, Geschlossenheit und Öffnung, Fläche und Raum geht mit dem Umschlag von Positiv und Negativ einher, erst recht wenn die Farbpartien sich überlagern oder als Duktus frei auslaufen. Björn Knapp zeigt Sachverhalte, die, stabil, als feste Formen vorgetragen sind und deren Betrachtung und Deutung doch nie an ein Ende kommt: Das Nachdenken darüber wird zum wahren Vergnügen im Spiel der Formen, die mit ihren Andeutungen ja auch humorvoll wirken können.
Björn Knapp wurde 1988 in Bensheim an der Bergstraße geboren. Er studierte zunächst an der Kunstakademie Karlsruhe bei Gustav Kluge (einem Maler) und Marcel van Eedem (einem konzeptuellen Künstler) und wechselte dann an die Düsseldorfer Kunstakademie, zunächst zu Andreas Schulze und dann zu Thomas Scheibitz, bei dem er 2020 als Meisterschüler abgeschlossen hat. Aus seiner Beteiligung an der letztjährigen Ausstellung „Coming to Voice“ in K21 hat die Kunstsammlung NRW ein Bild erworben, auch der Kunstpalast hat ihn in seine Museumssammlung aufgenommen. Nominiert für das Stipendium Vordemberge-Gildewart, ist er bis Mitte Februar an der Ausstellung der Finalisten im KIT am Mannesmannufer beteiligt – weiteres folgt bald.
Björn Knapp - End or Fin, bis 19. Februar bei SETAREH X, Hohe Straße 53 in Düsseldorf.
Björn Knapp ist außerdem beteiligt beim Stipendium Vordemberge-Gildewart 2021, bis 13. Februar im KIT – Kunst im Tunnel, Mannesmannufer 1b
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„MITGIFT“, 2025 von Tayyib Sen
Ingrid Wiener
Das Leben in der Kunst
Stadt der Fotografinnen
„Perspektivwechsel“ im Stadtmuseum
Trisha Donnelly
Konzentrate der Wahrnehmung
Wände ohne Bilder
Hans-Peter Feldmann im Kunstpaalast
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
Anna Schlüters Blick auf „SELBSTPORTAIT MIT ADLERTATTOO“, Diptychon 2025 von Felix Giesen
Simon Schubert – Lichtlinien
Ausstellung der Brunhilde Moll Stiftung 12.10.25 - 31.1.26
Theater und Konzert im Dialog: DER GARTEN
5. Oktober 2025 im TEMPLUM Düsseldorf
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„ESP 06“, 2022 von Corina GERTZ
Lorenzo Pompa
Formen der Figur
Einfache Situationen
Reiner Ruthenbeck in der Skulpturenhalle bei Neuss
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
WAS BLEIBT…? 2025 von Laura Maria Görner
K.U. Wagenbach
Material als Sprache
Von Düsseldorf in die Welt
Wim Wenders in der Bundeskunsthalle Bonn
Die Stunde der Sammler
Die Sammlung Miettinen in der Philara Collection in Flingern
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
SEE YOU DOWN BELOW THE SNOW MOUNTAIN von Ana Korkia
Albrecht Fuchs
Eins mit dem Raum
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
REMIX 1, 2025 von Michael Schmidtmann
Charity Ausstellung Düsseldorfer KünstlerInnen
Vom 26.6. bis 13.7. im Weltkunstzimmer
Miriam Vlaming
Traumwandlerische Abwesenheit
Mensch im Leben
Thomas Schütte in Venedig und Hürth
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
THE CRADLE, 2025 von Yuhan Ke
New Design from Düsseldorf
Ausstellung von Absolvent*innen des Fachbereichs Design der Hochschule Düsseldorf im NRW–Forum
Im Dialog
Die Sammlung der Kunstakademie am Burgplatz